Wohnen sozial und grün
Positive Effekte von Grünflächen auf die physische, aber auch die psychische und soziale Gesundheit des Menschen sind inzwischen unbestritten. Die Coronapandemie hat uns vor Augen geführt, wie wichtig und bereichernd Grünräume in unseren Städten sind. Sie sind Orte der Erholung, Kommunikation und Freizeitgestaltung, und sie nehmen zugleich bedeutsame ökologische und klimatische Funktionen wahr. Qualitätsvolle Grünräume sind jedoch sehr unterschiedlich verteilt, was zu Fragen der gleichwertigen Lebensverhältnisse und „grünen Gerechtigkeit“ führt.
Eine der zentralen Herausforderungen ist insbesondere die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum, der in ein attraktives grünes Wohnumfeld eingebettet ist. Die Schwierigkeit der Realisierung von sozialem und zugleich grünem Wohnen liegt darin, dass Quartiere mit attraktiven Grünanlagen nahezu automatisch dem gehobenen Preissegment zuzuordnen sind. Wo Freiflächen und Parks sind, steigen die Mieten, und wo es grüner und schöner wird, zieht es die wohlhabenden Bevölkerungsschichten hin. Dies sind Effekte der sogenannten grünen Gentrifizierung. In der Praxis der Stadtentwicklung der vergangenen Jahrzehnte hat das dazu geführt, dass ärmere Stadtviertel in der Regel wenige Grünflächen aufweisen, während wohlhabende Quartiere üppig mit Gärten, Parks und Bäumen ausgestattet sind.





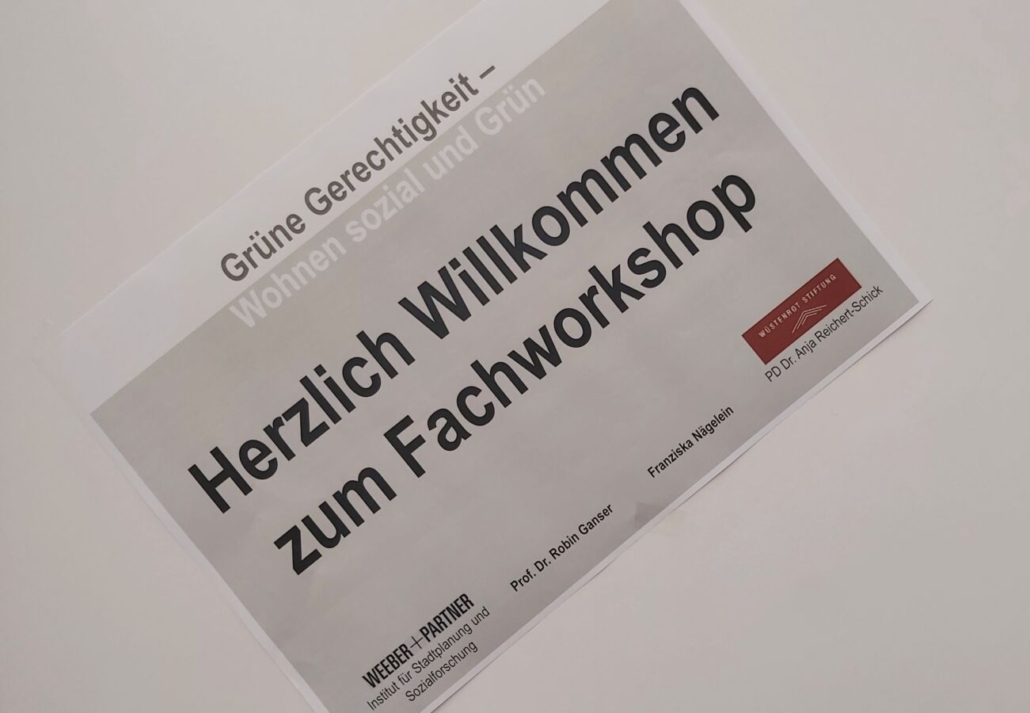
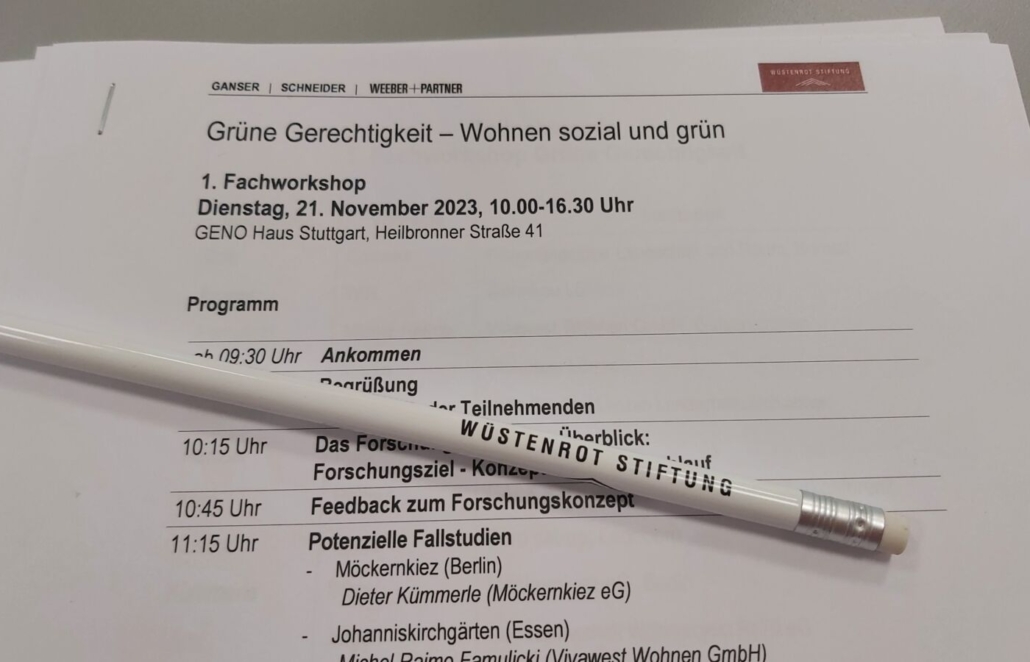














 Foto: Thomas Wolf © Wüstenrot Stiftung
Foto: Thomas Wolf © Wüstenrot Stiftung Foto © Wüstenrot Stiftung
Foto © Wüstenrot Stiftung